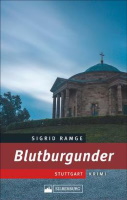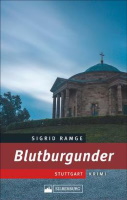PROLOG
In Stuttgarts Talkessel stand die Luft heiß, staubig und totenstill.
Die Erdkrater, aus denen in unabsehbarer Zeit für über acht Milliarden Euro der neue unterirdische Hauptbahnhof entstehen sollte, und die unzähligen Tunnelröhren, die sich aus diesem Anlass durch den städtischen Untergrund fraßen, entließen Dreckschwaden wie bei bevorstehenden Vulkanausbrüchen.
Die Bauarbeiter schufteten inmitten von Staub und Hitze zwischen Ungetümen von Kränen, Baggern und Schwerlastern.
Von den hechelnden Passanten auf Stuttgarts Straßen waren nur die glücklich zu schätzen, die ihren Arbeitsplätzen in klimatisierten Büros oder Kaufhäusern zustrebten.
Die Krankenhäuser füllten sich mit Herz- und Asthmakranken.
Dem Feinstaub war weder mit Mooswänden noch mit Wasser beizukommen.
Wer nicht zu arbeiten brauchte und keinen Garten mit einem Schatten spendenden Baum hatte, flüchtete aus seinen vier Wänden, die die Hitze gespeichert hielten. Man verzog sich in eins der Freibäder oder unter Sonnenschirme und Markisen von Biergärten und Straßencafés, denn auch in den bewaldeten Höhenlagen Stuttgarts war keine Abkühlung mehr zu erhoffen.
Aber nicht nur die Städter litten. Mittlerweile trockneten die Flüsse aus, und die Schifffahrt kam zum Erliegen. Auf dem Land begann die Ernte zu vertrocknen. Früher als sonst mussten Getreide, Mais und andere Feldfrüchte eingefahren werden. Die Landwirte jammerten über Ernteausfälle, und der Staat sah sich für Hilfe bei den finanziellen Einbußen in der Pflicht.
Doch inmitten all des Hitzestresses erschien unverhofft ein Wunder: Die Weinbaugebiete in ganz Deutschland erlebten eine einzigartige Sensation. In dem maritimen Klima, das ganz Europa im Griff hatte, gediehen die Reben und ihre Früchte so prächtig wie nie zuvor in diesen Breitengraden.
Darüber freuten sich auch die Wengerter im Schwabenland.
Trockenheit und hohe Temperaturen sorgten für gesunde Trauben mit ungewöhnlich hohen Öchslewerten. Man witterte eine Rekordernte, die Spitzenweine zu bescheren versprach.
Die Weinlese konnte schon Anfang September, also drei bis vier Wochen früher als üblich, beginnen.
Mitte September stiegen im Weinberg des Winzers Johannes Hufnagel ein Dutzend Erntehelfer von morgens bis abends die steilen Hänge zwischen den Weinstöcken auf und ab. Sie schnitten die kompakten schwarzblauen Burgundertrauben von den Reben und trugen sie in Bütten zu Tal. Diese Weinsorte, Pinot Noir oder Spätburgunder genannt, gilt als Klassiker der Rotweine für gehobene Ansprüche. Die Erntearbeiten mussten vorsichtig vor sich gehen, denn die Früchte des hochwertigen Schwarzburgunders haben eine dünnere Schale als andere Weinsorten.
Die Hauptarbeit und Verantwortung lagen auf den Schultern Hufnagels. Tatkräftig unterstützt wurde er von seinem zuverlässigsten und treuesten Mitarbeiter Sinan Arslan. Sinan, der vor mehr als dreißig Jahren aus Anatolien nach Schwaben eingewandert war, hatte sich damals nicht wie die meisten Gastarbeiter um gut bezahlte Fließbandarbeit bei Daimler oder Bosch beworben, sondern die Schwerstarbeit auf den Weinhängen rund um Uhlbach vorgezogen. Er hatte ein Mädchen aus dem Nachbarort Rotenberg geheirate, hatte das hübsche, lebenslustige Hannele ihren zahlreichen Verehrern vor der Nase weggeschnappt. Ihre Töchter hatten außer ihrer schlanken Figur äußerlich nichts von ihrer geerbt, sondern glichen ihrem Vater. Beide hatten seine bräunliche Haut und seine schwarzen Augen. Ihr klassisches Profil mit der schmalen geraden Nase und ihre vollen geschwungenen Lippen verdankten die beiden den weiblichen Generationen aus Sinans Familie.
Mittlerweile waren Ayse und Perihan fünfzehn und siebzehn Jahre alt. Seit mehreren Jahren halfen sie Johannes Hufnagel jeden Herbst bei der Weinlese.
Auch am vergangenen Sonntag waren sie bei der Lese des Spätburgunders am Götzenberg dabei gewesen. Obwohl die Mädchen fleißig arbeiteten, hörte man ihr übermütiges Lachen und Schwatzen wie Vogelgezwitscher durch die Rebenreihen schallen. Die anderen Erntehelfer sprachen nur das Nötigste miteinander, weil sich alle beeilten, die kostbare Ernte vor dem angekündigten Wetterumschwung, der Regen und Hagel bringen sollte, einzufahren.
Das Wetter hielt. Erst als am späten Nachmittag alle Trauben in der Kelter waren, brach mit Urgewalt ein kurzer Regenschauer los. Schon nach zehn Minuten ging er in dünnes Nieseln über, das bis Mitternacht anhielt und die Wege und Stäffele in den Weinbergen nass und glitschig zurückließ.
. . .
Kripohauptkommissar Peter Schmoll saß an diesem Morgen wie immer als Erster im Polizeipräsidium an der Hahnemannstraße. Nach einem langweiligen Abend, den er mit mehreren Trollinger-Vierteles verbracht hatte, und einer unruhigen Nacht war Schmoll morgens froh gewesen, zu seiner Arbeit im Präsidium fahren zu können.
Kurz vor acht Uhr ging der Anruf bei ihm ein, dass in den Weinbergen zwischen Rotenberg und Uhlbach ein totes Mädchen liege und ein Verbrechen nicht auszuschließen sei. Schmoll zog seine hohe Stirn und die halbe Glatze zu Wellblech, seufzte und stemmte seine eineinhalb Zentner Lebendgewicht aus dem Bürostuhl. Während er seine Jacke anzog und den Dienstausweis einsteckte, flatterte die junge Kommissarin Irma Eichhorn ins Büro. Ihr Pferdeschwanz aus kupferroten, gekräuselten Haaren war zerzaust, weil sie wie üblich mit dem Fahrrad zum Dienst gekommen war. Irma zwitscherte ihrem Chef ein norddeutsches »Moin moin« entgegen, ihren Gruß, an dem sie auch nach mehreren Dienstjahren in Stuttgart festhielt. Aus dem grantigen »Grüß Gottle«, das Schmoll erwiderte, ahnte sie, dass schlechte Neuigkeiten in der Luft lagen. Schmoll erklärte in Kurzfassung, dass es eine Leiche gebe und diese irgendwo in den Weinbergen zwischen Rotenberg und Uhlbach liege.
Irma zog gar nicht erst die Jacke aus, sondern folge Schmoll zum Parkplatz, wo sein Daimler stand. Der Daimler war ein in die Jahre gekommenes Gefährt, das Schmoll maßlos liebte, und um das er sich sorgte, weil es demnächst dem Dieselfahrverbot zum Opfer fallen würde.
Kaum hatte sich Schmoll in seinen Wagen gewuchtet und Irma die Beifahrertür zugeknallt, sagte sie: »Der Tag fängt ja gut an!«
Schmoll knurrte in seinem besten Bass, der heute besonders tief klang und wie immer, wenn er nicht gut drauf war, ins Schwäbische abrutschte: »Meinscht des Wetter oder die Leich?«
»Beides«, sagte Irma.
Damit begann die Stop-and-go-Fahrt in Stuttgarts morgendlicher Rushhour über Bad-Cannstatt nach Obertürkheim. Irma, die gestern mit ihrem Freund Leo ziemlich lange in einer Besenwirtschaft gezecht hatte, hätte am liebsten ein Nickerchen gemacht. Aber das war leider unmöglich, weil Schmoll die ganze Zeit lautstark über die anderen Verkehrsteilnehmer fluchte, die es ihm nie recht machen konnten: »Der Depp woiß net, dass mer de Blinker setze muss.« – »Ein Dreck werd i ond di vorbeilasse. Wenn‘s pressiert, ko mer net schnell gnug langsam do.« Dazwischen knallte Schmoll seine Lieblingsschimpfwörter »bleeder Seggel« oder »Allmachtsdackel« auf die Autofahrer, die seiner Meinung nach keine Ahnung von Verkehrsregeln hatten. Für Damen am Steuer hielt er Komplimente wie »bleede Schell« oder »daube Nuss« parat. Schmoll bemühte sich zwar in der Regel ums Hochdeutsche, fluchte aber stets auf Schwäbisch. Fürs Schwäbische war Kommissar Katz, der Dritte in Schmolls engerem Team, zuständig. Irma, das Nordlicht aus Itzehoe, hatte lange gebraucht, um ihren Kollegen Steffen Katz zu verstehen, aber er hatte ihr auch geholfen, sich an den Dialekt zu gewöhnen.
Nachdem Schmoll seinen klapprigen Daimler über die Pragstraße, entlang der Wilhelma und des Rosensteinparks bis zum Mineralbad Leuze gequält hatte, lag der dickste Stadtverkehr hinter ihnen, und es ging nun ziemlich flott über die Neckaruferstraße voran. Schmoll fluchte jetzt nicht mehr über den Verkehr, sondern über Katz: »Muss der Lombaseggel emmer genau dann em Urlaub romgammle, wenn mir en Fall mit rer Leich uff dr Tisch krieget?«
»Katz hat heute einen Tag freinehmen müssen, weil seine Oma krank ist«, erinnerte Irma.
Schmoll knurrte irgendwas Versöhnliches und bog von der Schnellstraße nach Obertürkheim ab. Er überquerte auf der Otto-Hirsch-Brücke den Neckarhafen, und ab hier tuckerten sie gemächlich bergauf.
Nachdem sie oben die Friedhofmauer und die Kirche, den Uhlbach-Platz und das Weinbaumuseum hinter sich gelassen hatten, fuhren sie ein Stück die Trollingerstraße entlang und gerieten dann auf die Götzenbergstraße. Ungefähr dort tauchte vor ihnen über Uhlbachs Dächern der Kegelberg mit der berühmten Kapelle auf. Prompt erzählte Schmoll zum x-ten Mal die Geschichte der so jung gestorbenen russischen Zarentochter Katharina, für die ihr Gemahl König Wilhelm I. den verfallenen Stammsitz der Württemberger abreißen ließ, um eine Grabkapelle für sie erbauen zu lassen.
Seit Irma diese Kapelle, die wie ein verwunschenes Tempelchen weithin sichtbar inmitten der Weinberge über dem Neckartal steht, das erste Mal entdeckt und Schmoll ihr das erste Mal diese Geschichte erzählt hatte, nannte Irma die Grabkapelle den schwäbischen Tadsch Mahal. Leider sah Irma heute die grüne Kuppel nur vage durch den Nebel schimmern. Nach der langen Hitzeperiode hatte in der vergangenen Nacht ein Regenschauer für einen feuchten Morgen gesorgt. Doch die Sonne versuchte bereits, die Dunstschleier von den Weinbergen zu ziehen.
|